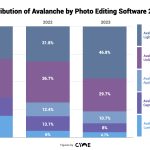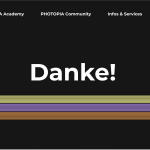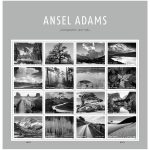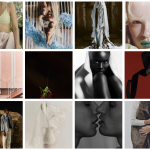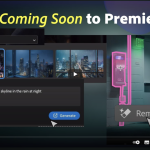In seiner Kolumne reagiert Hendrik Neubauer auf einen aktuellen Zensurfall auf Facebook und streift die Frage: Lässt sich mit dem prüden Zuckerberg überhaupt Journalismus machen?
Am 9. September 2016 veröffentlichte die Tageszeitung „Aftenposten“ auf der Titelseite einen offenen Brief des Chefredakteurs Espen Egil Hansen an Mark Zuckerberg. (1) Er prangert in seinem Schreiben das Zensurverhalten des Zuckerberg-Unternehmens Facebook an. Was ist da los?

Mitte August hat Facebook einen Post des norwegischen Journalisten Tom Egeland auf Facebook gelöscht. In diesem Beitrag wurden sieben Fotos vorgestellt. Die fotografischen Dokumente hätten die Geschichte der Kriegsführung beeinflusst, schreibt Hansen. Ein Dokument zeigt das Motiv „Napalm Girl“, aufgenommen von Nick Ut. Das Foto zeigt ein vietnamesisches Mädchen, es ist nackt, ihr Körper ist napalmverbrannt und im Hintergrund ist ein Dorf zu sehen. das in Flammen steht. „Aftenposten“ hatte diesen Beitrag geteilt. Mittlerweile hat Facebook nicht nur den Beitrag Egelands gelöscht, der aufmüpfige Journalist traf auch Bannstrahl des Unternehmens und selbst vor der Nachrichtenseite machten Zuckerbergs Erfüllungsgehilfen nicht halt. Eine der Ikonen der Kriegsfotografie wurde aus dem Sozialen Netzwerk gelöscht, da in dem Post das Nacktbilder-Verbot des Unternehmens verletzt werde.
Facebook bezieht sich in seinen Begründungen auf seine Community Standards. Dort heißt es zu Nacktheit und Pornographie: „Facebook verfolgt strikte Richtlinien gegen das Teilen pornographischer Inhalte sowie jedweder sexueller Inhalte, wenn Minderjährige beteiligt sind. Darüber hinaus legen wir Grenzen für die Darstellung von Nacktheit fest.“ Facebook schwingt sich in diesem Fall aber nicht nur zum globalen Sittenwächter. Facebook macht sich hier zum Chef von Mediaunternehmen wie „Aftenposten“, „Guardian“ oder „Spiegel Online“, die mittlerweile mit dem Angebot „Instant Articles“ versuchen, mehr Aufmerksamkeit für ihre eigenen Online-Angebote zu generieren. Und steht da nicht der Anspruch Mark Zuckerbergs im Raum sein Soziales Netzwerk zur „größten personalisierten Zeitung der Welt zu machen“? Hier schlägt uns jedenfalls Zensur entgegen, wie wir sie nur aus erzkonservatien Gesellschaften kennen.
Zurück zu Hansen und seinem Brief an Zuckerberg. Er wirft ihm vor, dass der Betreiber der Plattform ihn in seiner Arbeit als Chefredakteur der größten norwegischen Tageszeitung behindere. Zuckerberg missbrauche seine Macht und er könne kaum glauben, dass dieser seine Regeln und sein Verhalten das bis zum Ende durchdacht habe. Hansen kommt dann noch mal auf Ut zurück. „Napalm Girl“ sei eine der Ikonen des Vietnam-Krieges. Die Medien hätten damals eine entscheidende Rolle gespielt, den Krieg zu beenden.
Wie die Journalisten 1972 um die Veröffentlichung kämpfen und welche Kompromisse sie damals eingehen mussten, zeigt dieser zeitgenössische Bericht aus der AP-Redaktion: „Nick and Ishizaki prepared a selection of eight 5×7 inch prints for the next ‚radio photo cast‘ at 5 PM – but an editor at AP rejected the photo of Kim Phuc running down the road without clothing because it showed frontal nudity. Pictures of nudes of all ages and sexes, and especially frontal views were an absolute nono at the Associated Press in 1972. While the argument went on in the AP bureau, writer Peter Arnett and Horst Faas […] came back from an assignment. Horst argued by telex with the New York headoffice that an exception must be made, with the compromise that no close-up of the girl Kim Phuc alone would be transmitted. The New Yorker photo editor, Hal Buell, agreed that the news value of the photograph overrode any reservations about nudity.“(3)
Da man Schatten auf dem Körper Kim Phúcs als Schamhaare hätte deuten können, wurde der Abzug laut Denise Chong auf Bitte von Faas leicht retuschiert und damit entschärft. Darauf verweist der Medienhistoriker Gerhard Paul, in seinem Beitrag (4) blättert er zudem die Umstände auf, wie dieses Foto zur Ikone werden konnte. Hätte Ut seine Foto bespielsweise nicht beschnitten, hätte es wohl nicht diese weltweite und dauerhafte Wirkung entfalten können. Aber das ist ein anderes weites Feld.
Wir sollten in diesem Moment darüber reden, ob wir Sozialen Netzwerke folgen wollen, die uns schleichend langsam aber stetig mit ihren prüden Algorithmen in die „Steinzeit“ der Medien zurückführen wollen? Wofür haben Fotojournalisten wie Horst Faas und Nick Ut gekämpft? Wo sitzen in Zukunft die Chefredakteure? Ist Zuckerberg bereits der Boss? Espen Egil Hansen verweigert ihm die Gefolgschaft. Nachzulesen auf Seite 1 der „Aftenposten“-Printausgabe vom 9. September.
(1) Der Brief Espen Egil Hansens an Mark Zuckerberg. Aftenposten. 09.09.2016
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Dear-Mark-I-am-writing-this-to-inform-you-that-I-shall-not-comply-with-your-requirement-to-remove-this-picture-604156b.html
(2) Instant Artikel:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/facebook-und-journalismus-13592828.html
(3) Horst Faas/Marianne Fulton, How the Picture Reached the World, online unter URL: http://digitaljournalist.org/issue0008/ng4.htm
(4) Gerhard Paul, Die Geschichte hinter dem Foto. Authentizität, Ikonisierung und Überschreibung eines Bildes aus dem Vietnamkrieg, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 2 (2005), H. 2, URL: http://www.zeithistorische-forschungen.de/2-2005/id=4632, Druckausgabe: S. 224-245.